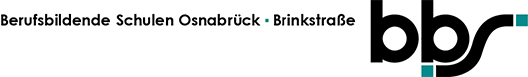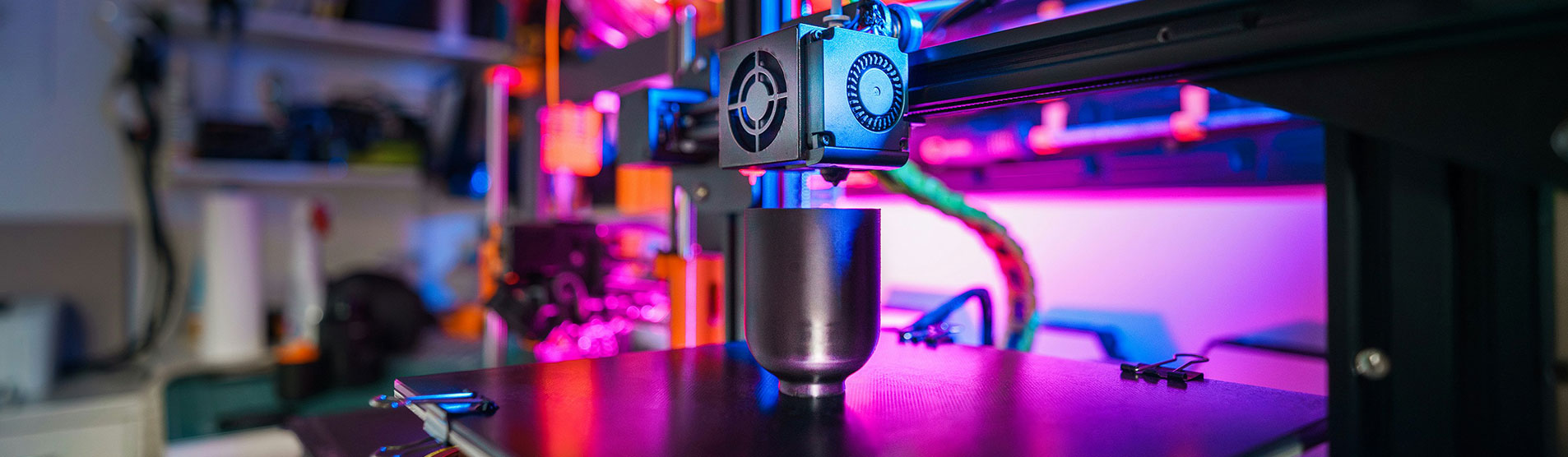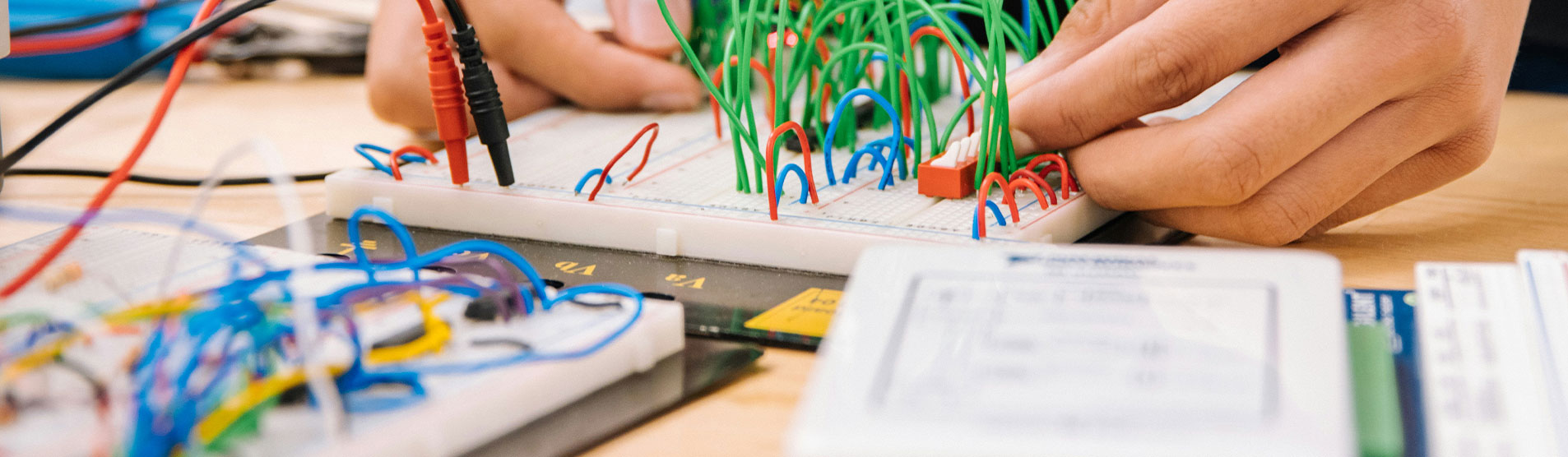Bildungsangebot
3.0: Modulbereich 3 im Überblick
| Modul 3: | Technische Lösungen entwickeln | |
| Zeitrichtwert: | 320 h | |
| Kompetenzen: | Personale Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler definieren, bewerten und reflektieren Ziele und Prozesse. Sie gestalten diese eigenständig und nachhaltig. Sie entwickeln eine offene Haltung zu innovativen Konzepten. Sie lösen komplexe fachbezogene Probleme und vertreten ihre Lösungen argumentativ gegenüber Fachleuten.
Fachkompetenz Die Schülerinnen und Schüler entwickeln komplexe technische Lösungen. Sie analysieren und dokumentieren Kundenanforderungen. Sie bereiten Fachgespräche vor, führen sie durch und dokumentieren sie. Sie klären und berücksichtigen rechtliche Rahmenbedingungen. Sie beurteilen fachliche Innovationen und setzen neue Technologien um. Sie wenden Kreativitätstechniken zur Produktentwicklung an. Sie setzen branchenspezifische Software zur Bearbeitung komplexer Aufgaben ein. Sie entwerfen und konstruieren technische Lösungen und führen Berechnungen durch. Sie wählen geeignete Rohstoffe, Werkstoffe bzw. Technologien für komplexe technische Lösungen aus. Sie berücksichtigen ökologische Aspekte und treffen nachhaltige und umweltgerechte Entscheidungen. Sie überprüfen kriteriengeleitet technische Lösungen. Sie erstellen technische Dokumente, ggf. Programme. Sie präsentieren technische Lösungen und übergeben sie an den Kunden. Sie reflektieren und beurteilen ihre Vorgehensweise und Handlungsergebnisse. | |
Struktur: (Modulbereiche) | Schwerpunktbereich: Energie- und Anlagentechnik | |
| MB 3.1 | MMO: Messverfahren und Messsysteme optimieren | |
| MB 3.2 | EEV: Elektrische Energiewandlungs- und Verteilungssysteme planen und entwickeln | |
| MB 3.3 | LFAE: Lösungen für elektrische Anlagen entwickeln | |
| Schwerpunktbereich: Informations- und Automatisierungstechnik | ||
| MB 3.1 | MMO: Messverfahren und Messsysteme optimieren | |
| MB 3.2 | DB: Datenbanken zur Optimierung betriebswirtschaftlicher Prozesse | |
| MB 3.3 | STS: Software für technische Systeme entwickeln | |
3.1 (E-A) - Messverfahren und Messsysteme optimieren | MMO
| Schwerpunktbereich: Energie- und Anlagentechnik | |
| Modulbereich: | 3.1 - Messverfahren und Messsysteme optimieren |
| Kürzel: | MMO |
| Übersicht: | In diesem Modulbereich werden Messverfahren und Systeme betrachtet, die unter anderem dem Aspekt der Übernahme von Verantwortung in der Elektrotechnik Rechnung tragen sollen. Weiterhin werden in diesem Modul Messverfahren und Systeme betrachtet, die der Erfassung nichtelektrischer Größen dienen. Hier werden neben den klassischen Sensoren der Automatisierungstechnik auch Systeme aus dem Bereich der Maschinensicherheit genutzt. |
| Inhalte: |
|
| Arbeitsmittel: | Analoge Sensoren, Oszilloskop, Messgeräte |
3.2 (E-A) - Elektrische Energiewandlungs- und Verteilungssysteme planen und entwickeln | EEV
| Schwerpunktbereich: Energie- und Anlagentechnik | |
| Modulbereich: | 3.2 - Elektrische Energiewandlungs- und Verteilungssysteme planen und entwickeln |
| Kürzel: | EEV |
| Übersicht: | Die Schülerinnen und Schüler analysieren die wesentlichen Strukturen zur Bereitstellung elektrischer Energie. Hierbei berücksichtigen Sie im Wesentlichen Aspekte der:
Sie beurteilen zudem die Potenziale, Problemstellungen (technisch sowie gesellschaftspolitisch) von konventioneller und regenerativer Energieerzeugung. |
| Inhalte: | Aufbau von Energieversorgungssystemen
Wärmekraftwerke
Regenerative Energiequellen
Kraftwerkseinsatz
Gesellschaftliche und politische Aspekte der Energieversorgung
|
| Arbeitsmittel: | Synchronmaschine, diverse Messeinrichtungen (Strom- Spannungs- und Leistungsfaktormessgeräte), Fach- und Tabellenbücher, PC. |
3.3 (E-A) – Lösungen für elektrische Anlagen entwickeln | LFAE
| Schwerpunktbereich: Energie- und Anlagentechnik | |
| Modulbereich: | 3.3 – Lösungen für elektrische Anlagen entwickeln |
| Kürzel: | LFAE |
| Übersicht: | Die Schülerinnen und Schüler vergleichen unterschiedliche Übertragungssysteme zum Transport von elektrischer Energie und kennen deren Vor- und Nachteile in verschiedenen Anwendungsbereichen. Sie können in Drehstromsystemen die Spannungs- und Stromverhältnisse in symmetrischen und unsymmetrischen Stern- bzw. Dreieck-Schaltungen bestimmen und Übertragungswirkungsgrade berechnen. Charakteristische Kenngrößen von Transformatoren im Einphasen- und Drehstrombereich können ermittelt und entsprechende Ersatzschaltbilder dargestellt werden. Anlagen der Energieversorgung können durch Parallelschaltung von Transformatoren erweitert und die Lastverteilung bestimmt werden. Energiekabel und Freileitungen und werden aufgrund der Anforderungen normgerecht ausgewählt und entsprechend dimensioniert. Leitungen und Kabel können bezüglich Wechselstromeffekten beschrieben und Verluste sowie Spannungsfall durch die entsprechenden Leitungsparameter berechnet werden. |
| Inhalte: | Übertragungssysteme analysieren
Transformatoren überprüfen und in bestehenden Anlagen erweitern
Energiekabel und Leitungen dimensionieren und auslegen
|
| Arbeitsmittel: | Verteil-/ Netzpläne, Datenblätter, MultiSim, Fachbuch |
3.1 (I-A) - Messverfahren und Messsysteme optimieren | MMO
| Schwerpunktbereich: Informations- und Automatisierungstechnik | |
| Modulbereich: | 3.1 - Messverfahren und Messsysteme optimieren |
| Kürzel: | MMO |
| Übersicht: | In diesem Modul werden Messverfahren und Systeme betrachtet, die unter anderem dem Aspekt der Übernahme von Verantwortung in der Elektrotechnik Rechnung tragen sollen. Weiterhin werden in diesem Modul Messverfahren und Systeme betrachtet, die der Erfassung nichtelektrischer Größen dienen. Hier werden neben den klassischen Sensoren der Automatisierungstechnik auch Systeme aus dem Bereich der Maschinensicherheit genutzt. |
| Inhalte: |
|
| Arbeitsmittel: | Analoge Sensoren, Oszilloskop, Messgeräte |
3.2 (I-A) – Datenbanken zur Optimierung betriebswirtschaftlicher Prozesse entwickeln | DB
| Schwerpunktbereich: Informations- und Automatisierungstechnik | |
| Modulbereich: | 3.2 – Datenbanken zur Optimierung betriebswirtschaftlicher Prozesse entwickeln |
| Kürzel: | DB |
| Übersicht: | Die Schülerinnen und Schüler analysieren die wesentlichen Merkmale einer relationalen Datenbank. Sie entwerfen das Entity-Relationship-Modell für eine Datenbank und führen eine Normalisierung zur Vermeidung von Redundanzen durch. Die Implementierung einer Datenbank geschieht nachfolgend auf einem SQL-Server. Dabei setzen die Schülerinnen und Schüler SQL-Anweisungen zum Einfügen, Ändern und Löschen von Datensätzen ein. Mit dem SELECT-Befehl werden komplexe Abfragen an die Datenbank gestellt. Darüber hinaus entwickeln die Lernenden Konzepte zur Realisierung der referentiellen Integrität und zum Erhalt der Datenkonsistenz. Für den Mehrbenutzerbetrieb der Datenbank kennen die Schülerinnen und Schüler das Benutzer- und Rechtekonzept eines SQL-Servers. |
| Inhalte: | Merkmale relationaler Datenbanken
Entwurf von relationalen Datenbanken
Implementierung einer SQL-Datenbank
Datenbankabfragen
Mehrbenutzerbetrieb
|
| Arbeitsmittel: | Datenbankmanagementsystem ACCESS, XAMPP-System mit SQL-Server |
3.3 (I-A) – Software für technische Systeme entwickeln | STS
| Schwerpunktbereich: Informations- und Automatisierungstechnik | |
| Modulbereich: | 3.3 – Software für technische Systeme entwickeln |
| Kürzel: | STS |
| Übersicht: | Die Schülerinnen und Schüler kennen verschiedene Verfahrensmodelle der Softwareentwicklung. Sie entwickeln für Steuergeräte Programme in einer Hochsprache. Sie nutzen dabei eine professionelle Integrierte Entwicklungsumgebungen. Zur Dokumentation Ihrer Programme verwenden sie Programmablaufpläne, Struktogramme und UML-Diagramme. Die entwickelte Software wird mit Hardware als auch mit Softwarewerkzeugen getestet. Dabei kommen professionelle Debugging Tools zum Einsatz. Für konkrete Übungen stehen in der Praxis etablierte Steuerungen, Mikrocontrollersysteme mit ARM-Cortex Controllern sowie ein autonomes mobiles Robotersystem zur Verfügung. Um die Unterrichtsziele zu erreichen, wird projekt- und handlungsorientiert gearbeitet. |
| Inhalte: | Verfahrensmodelle der Softwareentwicklung
Handhabung von Entwicklungswerkzeugen
Erstellen von Anwendungsprogrammen
Konfiguration und Verwendung spezieller On-Chip-Komponenten
Systemerweiterung unter Verwendung des I2C-Standards
|
| Arbeitsmittel: | Steuerungen, mbed LPC 1768, Visual Studio Code, Plattform IO, Mobiler Roboter, ESP32- System |